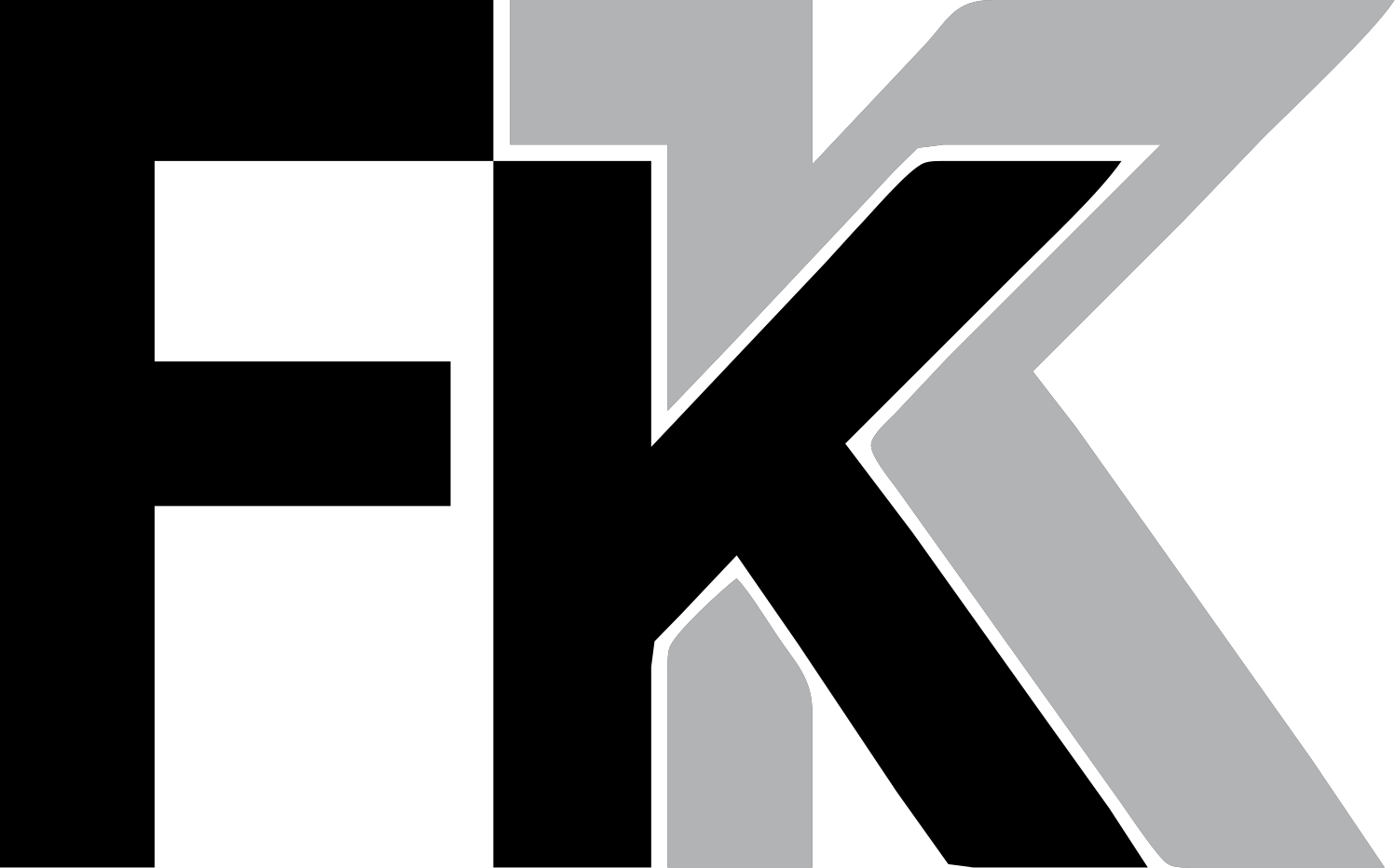Eigentlich
Eigentlich ist Rüsselsheim ganz schön.
Eigentlich baut Opel gute Autos.
Eigentlich.
Es sind nicht nur Volkhard Guth und Ernst-Erich Metzner, die Rüsselsheim einen gewaltigen Minderwertigkeitskomplex bescheinigen. Aber die Psychoanalyse einer Stadt, einer ganzen Stadtgesellschaft, ist kein Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchung. Vielmehr manifestiert sie sich im Fall Rüsselsheims an all den kleinen Symptomen dieses Komplexes, der die Stadtgesellschaft in ihrer Entwicklung immer wieder behindert oder zu eklatanten Fehlentwicklungen führt. Es ist das Lebensgefühl der Rüsselsheimer, die, immer wenn sie mit leicht gesenktem Kopf ihre Stadt beschreiben, mit »Eigentlich« beginnen.
Aber der Stadtpark ist sehr schön.

Rüsselsheim ist geprägt von einem internationalen Konzern, der in den »guten Zeiten« mehr Geld in die Stadtkasse spülte, als man ausgeben konnte. Das mit dem Ausgeben hat man aber relativ schnell gelernt. Das Selbstbewusstsein der Rüsselsheimer definierte sich darin, dem bösen US-Konzern, den Kapitalisten möglichst viel abzutrotzen. Lohnerhöhungen, Schichtzuschlag, Behindertenparkplätze, freigestellte Betriebsräte, ein paar Boni noch dazu. Nicht, dass dies nicht berechtigt gewesen wäre. Im Gegenteil. Letzten Endes definiert sich aber daraus ein Selbstverständnis, das nicht aus einer eigenen Stärke erwachsen ist, sondern nur aus dem Partizipieren an der Stärke anderer, an dem Geld »der Reichen«.
So ist Rüsselsheim zu einer Ansammlung von Wohltätern geworden, die das Geld den bösen Kapitalisten abnahmen und an die Armen und Bedürftigen verteilten.
Das heißt: Für alles und jeden wurde gesorgt, Vereine eingerichtet, Arbeitskreise geründet, Beiräte geschaffen. Über alle Sportvereine kommt noch mal ein Sportbund obendrüber, der dann für alle den Sportlerball organisiert … Wenn in anderen Städten sich der Gesangsverein im Hinterzimmer einer Wirtschaft traf, so bekam er in Rüsselsheim ein eigenes Vereinsheim gebaut, einen ganzen »Treff« hingestellt mit kostenlosen Proberäumen. Jedem Skatclub sein Trainingsraum. Man baute eine soziale Stadt mit eigenem Krankenhaus, Schulen, Kindergärten Spielplätzen, Schwimmbädern, einem eigenen Theater. Alles größer und schöner als anderswo. Das Geld dazu war ja da. Mit Stolz dem Kapital abgetrotzt. Ob das Engagement, das Verständnis auch dazu da war oder das Know-how, bleibt fraglich. Die von Nils Kraft gebrauchte Formulierung »Man inszenierte mit viel Geld großstädtisches Leben, ohne es wirklich zu leben«, trifft es da sehr gut. Auch heute noch kostet ein Schulkinderhaus in Rüsselsheim mal schnell 2,5 Millionen Euro.
In diesem Geiste ist auch ein ganz bestimmter Menschentyp entstanden. Kein Rüsselsheimer Phänomen, aber in Rüsselsheim bestimmt besonders ausgeprägt. Ein sozialdemokratisierter Mensch, der soziale Verantwortung demokratisch auf andere überträgt bzw., wenn man geschickt ist, auf sich übertragen bekommt. Dahinter steckt das vordergründig »soziale« Menschenbild, anderen helfen zu wollen. Was dieses Welt- und Menschenbild so perfide macht: Es funktioniert nur, wenn es genug »dumme« Leute gibt, denen man helfen muss. Die keine Verantwortung für sich selbst übernehmen können; die letzten Endes – man würde es so nie sagen – weniger wert sind als andere.
Schon mal drüber nachgedacht?
Und erstaunlicherweise taucht dann immer dieselbe Sorte »Gutmenschen*« auf, um den armen geknechteten Unmündigen zu helfen und eine Stimme zu geben.
Natürlich um sich dafür dann bezahlen lassen.
Als Abgeordnete, Sozialarbeiter, Gewerkschaftsfunktionäre.
Eine Heerschaar hilfloser Helfer, einäugige Könige unter Blinden.
Die Standortsicherungsverträge aushandeln, die das Papier nicht wert sind, auf das sie gekritzelt wurden, wenn eben die Autos, die produziert werden, niemand kauft.
In diesem System haben sich viele Ruhige-Kugel-Jobs generieren lassen. Jobs, bei denen man von der eigentlichen Maloche freigestellt wird. Begehrte Posten mit allerlei Vergünstigungen. Jobs, deren Effizienz kaum überprüft wird. Ja, deren Überprüfung sich an sich schon verbietet, denn es sind ja Jobs, bei denen man »soziale Verantwortung« übernommen hat. Und in diesem Weltbild, in dem dann einige denen helfen, die nicht selbst für sich verantwortlich sind, gibt es für Fehler auch keine Konsequenzen. Die Motivation, anderen helfen zu wollen, wird zum Verhinderer jedweder Qualitätsdiskussion. Jo Dreiseitels verheerende Sozialpolitik der letzten zwölf Jahre ist Ergebnis dieser Denke. Können Sie sich an ein einziges Projekt erinnern, das innovative neue Konzepte im Sozialbereich etabliert hätte? Statt präventiv soziale Härtefälle zu vermeiden, vermeldete Jo Dreiseitel ganz asozial und voller Stolz die Steigerung der Ausgaben für soziale Härtefälle.
Krank.

Diese permanente Vermeidung einer Qualitätsdiskussion ist nicht nur Ursache des desolaten Zustandes vieler Dinge in Rüsselsheim, es ist eben auch einer der Gründe für das mangelnde Selbstbewusstsein der Rüsselsheimer. Wenn alle vermeintlichen Erfolge nur Resultat der Vermeidung einer ehrlichen Kritik sind, wo soll da auch ein wirkliches Selbstbewusstsein her kommen? Von einer Qualitätsverbesserung mal ganz zu schweigen.
Ähnlich ist es um die vielbeschworene »Streitkultur« in Rüsselsheim bestellt. Oft wird darunter fälschlicherweise der Streit als solcher verstanden, und eben nicht eine Kultur, die sich dadurch auszeichnet, über die Sache trefflich und mit Inbrunst zu streiten, ohne dabei ständig persönlich beleidigt zu sein. In einer Stadt ohne selbstbewusste Bürger passiert aber genau das: Man mokiert sich über die Form der Auseinandersetzung und weicht so jeder inhaltlichen Debatte aus, der am Ende immer eine Qualitätsverbesserung des Streitgegenstandes folgen würde. Können Sie sich an irgendeinen Vorfall in Rüsselsheim erinnern, bei dem mal jemand einen Fehler eingeräumt hätte? An ein Projekt, das als ehrlicher Versuch mit dem Wagnis des Misserfolges begonnen und mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme am Ende des Versuches geendet hätte? Nein, denn dazu bräuchte es Selbstbewusstsein. Mangelnde Streitkultur bedeutet auch: Wer Probleme offen anspricht, ist ein Schlechtredner und Nestbeschmutzer. Auf die Idee, dass es Kritikern – von denen wir viel mehr in Rüsselsheim bräuchten – um eine Verbesserung des Gesamtzustandes und nicht um die Bloßstellung etwaiger Handelnder geht, kämen nämlich nur Menschen mit Selbstbewusstsein. Auf der Strecke in diesem Klima bleibt der Diskurs.
Und das prägt.
Es prägt handelnde (oder dies zumindest vorgebende) Akteure vor Ort. Jens Grode ist dafür ein trauriges Beispiel. Der selbst als Hobbyradiomoderator tätige Fraktionschef der SPD, Organisator der »Geschichtstouren« seines Bundestagsabgeordneten, ist nicht in der Lage, im Fall Köbel ein Urteil zu fällen. Bösartig, wer dahinter Taktik vermutet. Vielmehr ist auch hier der Grund in mangelndem Selbstbewusstsein und völliger Hilflosigkeit zu suchen. Man hätte erwarten können, dass der Politikwissenschaftler Grode in der Lage sei, nach der Lektüre der Dissertation des Herrn Köbel und mit Kenntnis seines Verleugnens nach ‘45, zu entscheiden, ob dieser Mann weiterhin Namensgeber einer städtischen Halle sein soll. Dafür hat er sich als Volksvertreter wählen lassen. Doch wie so oft in Rüsselsheim endet die Flucht vor der Verantwortung in der Beauftragung eines Gutachtens – je niedriger das Selbstbewusstsein, desto höher die Gutachtenanzahl. Und das ganze lässt man die Stadt, also den Bürger, bezahlen. Hier zeigt sich auch ein grundlegendes Missverhältnis zu städtischen Geldern, aber dazu später mehr. Ein selbstbewusster Fraktionschef hätte sich für ein Zusatzschild stark gemacht, er hätte Verantwortung übernommen, auch finanziell, hätte aus der Parteikasse bezahlt, was man nun den Bürgern unterschiebt. Jens Grode wird in der Auseinandersetzung zum Getriebenen des eigenen Mangels an Courage. Sätze wie »Deine einseitige Kritik an der SPD – egal was sie macht – wird eben wieder deutlich« sind symptomatisch. Einer inhaltlichen Argumentation wird sich durch die Flucht in Formalien und Pauschalisierungen entzogen.
Wer nicht wie die Grodowski-Fraktion in der SPD mangels Selbstwertgefühl den Blick für die Bedürfnisse der Menschen verliert, der weiß, dass meine Beschreibung der Verhältnisse keine Kritik an sozialem Engagement, der SPD als solche oder sozialer Gerechtigkeit ist.
Im Gegenteil: In diesem Klima entstehen mangels Qualitätsdiskussion die größten Ungerechtigkeiten.
Der Begriff Sozialdemokratisierung, die in Rüsselsheim auch vor Unternehmern und der CDU nicht haltmacht, beschreibt vielmehr die spezifische Rüsselsheimer Entwicklung unter dem Einfluss eines Weltkonzerns mit seinen speziellen Arbeitssituationen und seinen Auswirkungen auf die ihn umgebende Gemeinde, die die Menschen vor Ort prägte und die letzten Endes zu diesem Minderwertigkeitskomplex geführt hat.
Das mangelnde Selbstbewusstsein resultiert aber auch aus der Tatsache, dass vor Ort ein Konzern war, bei dem das Geld am Fließband entstand.
Es gab also immer einen, der noch mehr verdiente.
In Detroit.
Ergo waren alle anderen benachteiligt. Bedürftig.
Der Opelarbeiter, über Tarif und mit Zuschlägen versorgt, war ein König gegenüber anderen Industriearbeitern – doch er war gegenüber GM immer noch der arme Opelarbeiter. Der örtliche Unternehmer, dick im Baugeschäft – gegen GM ein kleiner Fisch. Bedürftig. Es entstand eine Gemeinde von Bedürftigen – unabhängig vom Einkommen. Eine unselbstständige Stadtgesellschaft in der Verantwortung immer delegiert wurde. Eine Gemeinde, in der Eigeninitiative kapitalistisch, später neoliberal ist, in der Unternehmertum als solches verwerflich war. Diesem Vorwurf konnte man sich natürlich entziehen, wenn man gleichzeitig SPD-Mitglied war ;-)
Herausragendstes Beispiel dieses gebrochenen Selbstverständnisses ist der Gewerbeverein. Nicht eine der ohnehin fragwürdigen Veranstaltungen, die dieser Verein aus eigener Kraft hinbekommen hätte. Immer nur mit städtischer Unterstützung. Zuletzt der sogenannte Gewerbeball. Während in anderen Städten Unternehmer Gewerbebälle organisieren, bei denen dann fünfstellige Beträge an eine soziale Einrichtung gespendet werden, musste der Rüsselsheimer Gewerbevereinspräsident den Ball absagen, weil er 4.000 Euro nicht zusammen bekam.
Beschämend.

Der Weihnachtsmarkt, den man natürlich wieder »für die Bürger« machen wollte, hätte die Stadt – also die Bürger – 50.000 Euro gekostet. Und die imageschädigenden Veranstaltungen auf Rüsselsheims teuerstem Hinterhof – macht man natürlich auch nur für die Bürger.
Mein Gott, gebt doch einfach zu, dass ihr das für euer Geschäft oder für eure eigene Profilierung macht!
Ach so, dann kann man natürlich auch keine Steuergelder abstauben, gell?
Wie sehr wünschte ich mir ein paar Unternehmer in Rüsselsheim mit dem nötigen Selbstbewusstsein, die ihre Afterwork-Partys selbst organisieren, die nicht ständig um Gelder betteln, sondern ihren Mist selbst bezahlen. Die aber auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein mal sagen, wie viele Arbeitsplätze sie hier schaffen, wie viele Steuern sie hier zahlen, und die im Gegenzug mal ein ordentliches Breitbandnetz fordern, statt nach Zuschüssen für ihre peinlichen Festchen zu jammern. Es bleibt die Erkenntnis, dass ein wie auch immer geartetes selbstbewusstes Bürgertum in Rüsselsheim nie entstanden ist. Echte Unternehmer, die auch nur ein Fünkchen von dem Pioniergeist hätten, der Adam und Sophie Opel ausmachte. Pustekuchen. Die immensen Geldmittel, mit denen man früher alle Probleme trotz mangelnder Kompetenz irgendwie lösen konnte, haben eine Gesellschaft von Unmündigen geschaffen, egal ob Bedürftiger oder Wohltäter, deren einziger Weg aus jeder Misere der Ruf war:
»Da müsste die Stadt mal was machen!«
Mit »machen« war meist »bezahlen« gemeint.
Die Stadt? Das war Opel.
Städtisches Geld, das war Opel-Geld.
Also eigentlich nicht unser eigenes. Insofern unterblieb auch die Erkenntnis, dass dieses städtische Geld unser aller Geld ist. Steuergeld, von allen, sozial gestaffelt, bezahlt und in einem demokratischen Prozess für allgemeine Aufgaben wieder ausgegeben, kommt allen Bürgern zu Gute. Damit nicht jeder seine eigene Abwasserleitung bauen muss. Dieser Erkenntnismangel eines grundlegenden solidarischen Systems unserer Gesellschaft ließ sich auch immer an Stefan Gieltowskis dämlichem Argument festmachen: »Das bezahlt das Land!« Meist, um mal wieder eine völlig sinnlose Ausgabe zu rechtfertigen. Als wäre das nicht unser Geld. Dieses zutiefst unsoziale Verhältnis zu öffentlichen Mitteln legt auch Jens Grode an den Tag, wenn er die unnötigen Historikergutachten von den Bürgern bezahlen lässt. Aber woher kommt diese Unfähigkeit zu erkennen, mit wessen Geld man da um sich wirft? Steuergeld ist Geld, das man den Konzernen abgetrotzt hat. Dass ein immenser Teil des Geldes von Arbeitern erwirtschaftet wird, verdrängt man. Und gerade die, die auf Solidarität angewiesen wären, verdrängen es am meisten. Wenn man bei Opel den eigenen Jahreswagen zur besseren Rostvorsorge zweimal durch die Lackiererei fahren ließ, sich während der Arbeit sein eigenes Gartentor schweißte oder massenhaft Baumaterial für den Bungalow nach Hause schleppte, hat man sich eigentlich nur das genommen, was einem als Arbeiter sowieso zustand. Eine Gemeinschaft geschädigt? Quatsch. »Die habbe genuch Geld!« In einer Zeit, als der Laden noch reichlich Gewinn gemacht hat – kein großes Problem. Zu diesem wurde es erst, als der Laden dann »keinen« Gewinn mehr gemacht hat, als die Stadt kein Geld mehr hatte, um jedem seine eigene Autobahnauffahrt zu bauen.

Jetzt bricht auch das trügerische Selbstbewusstsein in sich zusammen. Woher die Kohle, die Stärke nehmen, wenn der, von dem alles kam, selbst nix mehr hat? Doch statt sich auf die eigene Stärke zu besinnen, wird weiter gejammert. Je niedriger das Selbstbewusstsein, desto höher das Anspruchsdenken. Die Stadt müsste mal was machen.
Die Stadt müsste diesen und jenen Verein retten, am besten sollte die Stadt gleich noch die Bürgerinitiative dazu gründen. Die Stadt müsste die Geschäfte erhalten in der Innenstadt.
Am besten Warengutscheine drucken.
Auch hier wurden Geschäfte als unternehmerischer Eigennutz nicht verstanden.
Der Rüsselsheimer glaubt, Einzelhändler machen das aus Spaß, und wenn die ihr Geschäft schließen, dann, um Kunden zu ärgern, und die Stadt muss das am besten verbieten. Das kommt natürlich auch daher, dass Rüsselsheimer Einzelhändler selbst nicht mal in der Lage sind, sich einen Einkaufsführer zu drucken, wenn die Stadt es ihnen nicht bezahlt. Und die sogenannte Linke steht nebendran und zeigt sich ebenso selbstbewusstloser denn je. Es gab eine Zeit, da haben Linke sich selbst organisiert, Sozialsysteme aufgebaut, Solidarität gelebt, langfristig gedacht. Fortschritt definiert. Heute jammern auch sie nur noch nach einem starken Staat und nach Subventionen. Die einen wittern hinter jeder Eigeninitiative neoliberalimperialistische Privatisierungsversuche und Weltherrschaftsbestrebungen, die anderen laufen als erwachsene Menschen in dümmlichen Leuchtwesten mit Ordnerbinden auf der zigsten Opel-Demo rum und fordern nur das, was ihnen ihre Funktionäre vorher genehmigt haben. In Rüsselsheim sammelt sich das Heer der Unmündigen. Alle gut Ausgebildeten, die den Mut und das Selbstbewusstsein haben, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, weil sie auch wissen, was sie können, haben bei Opel von sich aus gekündigt und arbeiten jetzt anderswo.
Auch in der Kulturszene setzt sich das Szenario fort. Man kann dieses Klima aus Einmischung, angstbesetztem, vorauseilendem Gehorsam und kompetenzlosen Doppelfunktionen kaum noch ertragen.
Schauspieler betritt den Raum: »Es tut uns leid, wir wollten halt auch mal etwas anderes Theater machen, eigentlich war es aber ganz anders gemeint, und wir hoffen, auch in Zukunft noch Geschäftsbeziehungen zu euch unterhalten zu dürfen. Wir machen auch wieder einen Handkäs’ Abend.«
Theaterleitung: »Nein, das war doch alles eigentlich ganz spannend.« Beide haben Tränen in den Augen.
Matthias Metz betritt den Raum: »Bitte macht euch keine Sorgen, ich habe als Kulturausschussvorsitzender eigentlich alles im Griff, und außerdem hat meine Partei die Idee, dass sich jetzt die freiwillige Feuerwehr um die leuchtenden Vorbilder kümmert. Übrigens, die Plakataufträge kann ich doch eigentlich weiter machen, oder?«
Alle fallen sich weinend, aber eigentlich glücklich in die Arme. Vorhang.
Einige im Publikum klatschen.
Dieses eigentliche »Lebensgefühl« wirkt nachhaltig in vielen Bereichen und hat dazu geführt, dass diese Stadt in ihrer Schreckstarre verharrt, statt die Chance für einen Neuanfang zu suchen, obwohl es nichts mehr gibt, auf das man noch Rücksicht nehmen müsste. Dennoch fehlt durchweg der Mut, irgendetwas Neues auszuprobieren, auch nur den kleinsten Schritt ohne dreifache Sicherung zu unternehmen. Und es fehlt völlig das Verständnis für die Faszination, die von dieser Stadt ausgeht. Mit Ihrer ganzen wechselvollen Geschichte, ihrer industriekulturellen Vergangenheit. Immer noch nennt der Rüsselsheimer, auf seine Herkunft angesprochen, die Festung und den Stadtpark. Die Festung ist ein oktroyiertes Militärgebäude, das auch der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung diente und Produkt einer unaufgeklärten monarchistischen Gesellschaft war, und dennoch steht es bei den Rüsselsheimern höher im Kurs als das, was sie mit ihren eigenen Händen aufgebaut haben.
Schlimmer kann sich mangelndes Selbstbewusstsein nicht manifestieren.

Es mag einer Generation, die am Opel-Hauptportal, Frau samt Kind gegenüber schon vor Augen, hinter der Schranke wie Vieh wartete, dass diese sich um 5 Uhr endlich hob, schwer fallen, Lohnarbeit auch als eigene Leistung zu begreifen. Man hat sich ja lange genug darin geübt, dies zu bejammern. Doch sollten nachfolgende Generationen in der Lage sein, sich aus der Distanz ein differenzierteres Bild von Rüsselsheim zu machen. In der Geschichte der Firma und der Stadt die eigenen Wurzeln zu entdecken und die – nicht im idealisiert idyllischen Sinne als schön zu bezeichnende – Stadt als umso spannender und faszinierender zu begreifen. Dann ließe sich auch ein selbstbewusstes Stadtmarketing verwirklichen, das über die permantene Selbstkasteiung hinausgeht und nicht jedem Besucher verschämt in’s Ohr flüstert:
»Eigentlich ist Rüsselsheim ja ganz schön.«.
Die Zeichnungen zeigen einige Gebäude in Rüsselsheim und deren großartige Architektur. Darunter Gebäude und Teile ganzer Ensembles – ich meine nicht das Hauptportal – die längst unter Denkmalschutz gestellt gehören, die zum Teil schon verunstaltet sind oder deren ästhetischer Wert in den wenigsten Fällen erkannt wird.
Denkmalschutz gilt eigentlich ja nur für die Festung.
Eigentlich.
7.9.2012
* Das Wort Gutmensch wurde hier zu einem Zeitpunkt verwendet, als es noch keine AfD gab und ist nicht in der diskriminierend Funktion zu verstehen, in der es diese und Ihresgleichen verwenden.